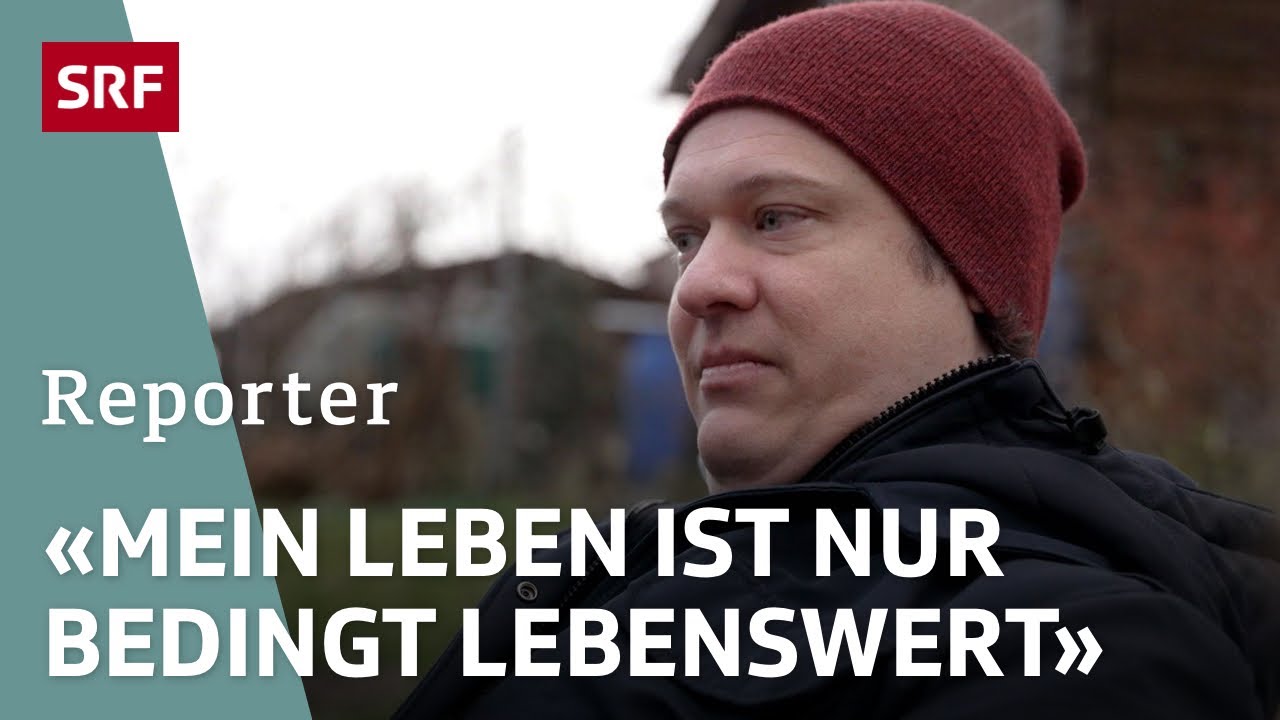Hör dir die Audio-Version dieses Artikels an (generiert von KI).
Long Covid – eine Krankheit, die so unsichtbar wie lähmend ist. Für die meisten Menschen ist die Pandemie inzwischen Vergangenheit, doch für viele Betroffene ist sie nie wirklich zu Ende gegangen. In der Schweiz gibt es zahlreiche Long-Covid-Patienten, deren Alltag durch die Krankheit stark eingeschränkt ist. Die Dokumentation beleuchtet eindrucksvoll das Leben einiger dieser Menschen und zeigt, wie schwer der Kampf um Anerkennung und Unterstützung in der Schweiz ist.
- Das Leben mit Long Covid: Eine nicht endende Herausforderung
- Sandra und Marc: Eine Beziehung im Ausnahmezustand
- Die medizinische Versorgung und das Gefühl, im Stich gelassen zu werden
- Das Leben in einem „gläsernen Käfig“: Der tägliche Kampf ums Überleben
- Ein Leben in Abhängigkeit von experimentellen Therapien und Selbsthilfe
- Ein Aufruf zur Anerkennung und Unterstützung
Das Leben mit Long Covid: Eine nicht endende Herausforderung
Die Dokumentation begleitet mehrere Long-Covid-Betroffene, darunter auch Otmar Hilliges, ein ETH-Professor, der durch die Krankheit völlig aus seinem aktiven Leben gerissen wurde. Vor seiner Erkrankung war er ein gefragter Experte und engagiert in seiner akademischen Karriere. Heute ist sein Leben von extremer Erschöpfung geprägt, die es ihm unmöglich macht, seine Arbeit und sein Privatleben wie gewohnt fortzusetzen.
Ebenso betroffen ist sein Sohn Kai, der ebenfalls an Long Covid leidet und seitdem auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Für diese Familie, wie auch für viele andere, hat die Pandemie nie wirklich geendet. Die körperlichen Einschränkungen, der Rückzug aus dem gesellschaftlichen Leben und der Verlust der vorherigen Lebensqualität sind Alltag.
Sandra und Marc: Eine Beziehung im Ausnahmezustand
Auch die Geschichte von Sandra und ihrem Freund Marc zeigt, wie stark Long Covid das Leben beeinträchtigt. Marc, einst sportlich und voller Energie, ist nun schwer krank. Die Krankheit hat ihre Beziehung verändert und stellt sie vor ständige Herausforderungen. Um die Beziehung zu erhalten, planen Sandra und Marc gezielt „gesunde“ Momente ein, um die Last der Krankheit nicht allzu sehr in den Mittelpunkt zu rücken. Doch diese Taktik kann die Realität nicht komplett ausblenden. Marc kämpft täglich mit extremen Erschöpfungszuständen, und das Paar sieht sich mit einem Alltag konfrontiert, der durch diese unsichtbare Krankheit völlig verändert ist.
Die medizinische Versorgung und das Gefühl, im Stich gelassen zu werden
Eines der größten Probleme für Long-Covid-Patienten in der Schweiz ist die fehlende medizinische Versorgung. Neurologin Maja Strasser, eine der wenigen Spezialisten für Long Covid, betreut über 160 schwer kranke Patienten, ist aber überlastet und kann keine Neuaufnahmen mehr machen. Für viele Betroffene bleibt daher nur die Hoffnung auf eine symptomorientierte Behandlung, denn spezielle, gezielte Therapien fehlen nach wie vor.
Otmar Hilliges drückt seine Frustration darüber aus, dass Long Covid von der Gesellschaft und den Behörden kaum ernst genommen wird. Die Krankheit wird in der Schweiz weder systematisch erfasst noch gibt es umfassende Studien oder Daten, die das Ausmaß der Betroffenheit dokumentieren. Diese fehlende Priorisierung führt dazu, dass viele Patienten ohne adäquate Unterstützung dastehen und sich selbst helfen müssen.
Das Leben in einem „gläsernen Käfig“: Der tägliche Kampf ums Überleben
Die Dokumentation zeigt eindrücklich, wie belastend das Leben für Long-Covid-Patienten ist. Miriam Hürster beschreibt ihre Situation als Leben in einem „gläsernen Käfig“. Sie sieht die Grenze ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit zwar nicht, spürt sie jedoch ständig und weiß, dass jede kleine Überanstrengung zu einem gesundheitlichen Rückschlag führen kann. Für sie, wie für viele andere, sind selbst alltägliche Aktivitäten wie Brot schneiden, trinken oder aufstehen eine enorme Belastung, die gut dosiert sein muss, um Schlimmeres zu verhindern.
Auch ihr Vater, der sie unterstützt, beschreibt die Veränderung seiner Tochter als schmerzhaft. Das lebenslustige, energische Mädchen von früher existiert nicht mehr, stattdessen ist Miriam in ein Leben der Isolation und Einschränkung gezwungen.
Ein Leben in Abhängigkeit von experimentellen Therapien und Selbsthilfe
Viele Betroffene greifen verzweifelt auf experimentelle Therapien zurück, da konventionelle Behandlungsmethoden fehlen oder nicht anerkannt sind. Therapien wie die Sauerstofftherapie oder die Blutwäsche (Apherese) sind teuer und werden von der Krankenkasse oft nicht übernommen. Patienten wie Marc und Miriam müssen hohe Summen aus eigener Tasche bezahlen, um sich eine geringe Chance auf Verbesserung zu erkaufen.
Sandra und Marc haben gemeinsam eine Art „Cocktail“ aus Nahrungsergänzungsmitteln und Medikamenten zusammengestellt, von dem sie sich Linderung erhoffen. Doch die Angst, dass etwas schiefgeht oder Nebenwirkungen auftreten, begleitet sie ständig. Die Unsicherheit und die Notwendigkeit, auf „Do-it-yourself“-Methoden zurückzugreifen, zeigt, wie schwer die Situation für Long-Covid-Betroffene ist, die vom Gesundheitssystem kaum unterstützt werden.
Ein Aufruf zur Anerkennung und Unterstützung
Die Dokumentation endet mit einem eindrücklichen Appell: Long Covid ist real, auch wenn es sich nicht auf einem Röntgenbild oder in einem Bluttest eindeutig nachweisen lässt. Die Betroffenen sind keine Zahlen, sondern Menschen, die dringend Anerkennung und Unterstützung brauchen. Sie kämpfen täglich gegen eine Krankheit, die kaum verstanden wird und für die es noch keine gezielte Behandlung gibt.
Fazit: Long Covid hat das Leben vieler Menschen nachhaltig verändert, und die Krankheit ist eine Herausforderung, der das Gesundheitssystem oft nicht gerecht wird. Was die Betroffenen am dringendsten brauchen, ist nicht nur medizinische Hilfe, sondern auch das Verständnis und die Solidarität der Gesellschaft. Denn nur gemeinsam können wir dafür sorgen, dass Menschen wie Otmar, Kai, Sandra, Marc, Miriam und viele andere eine Chance auf ein würdiges Leben und vielleicht eines Tages sogar auf Heilung haben.