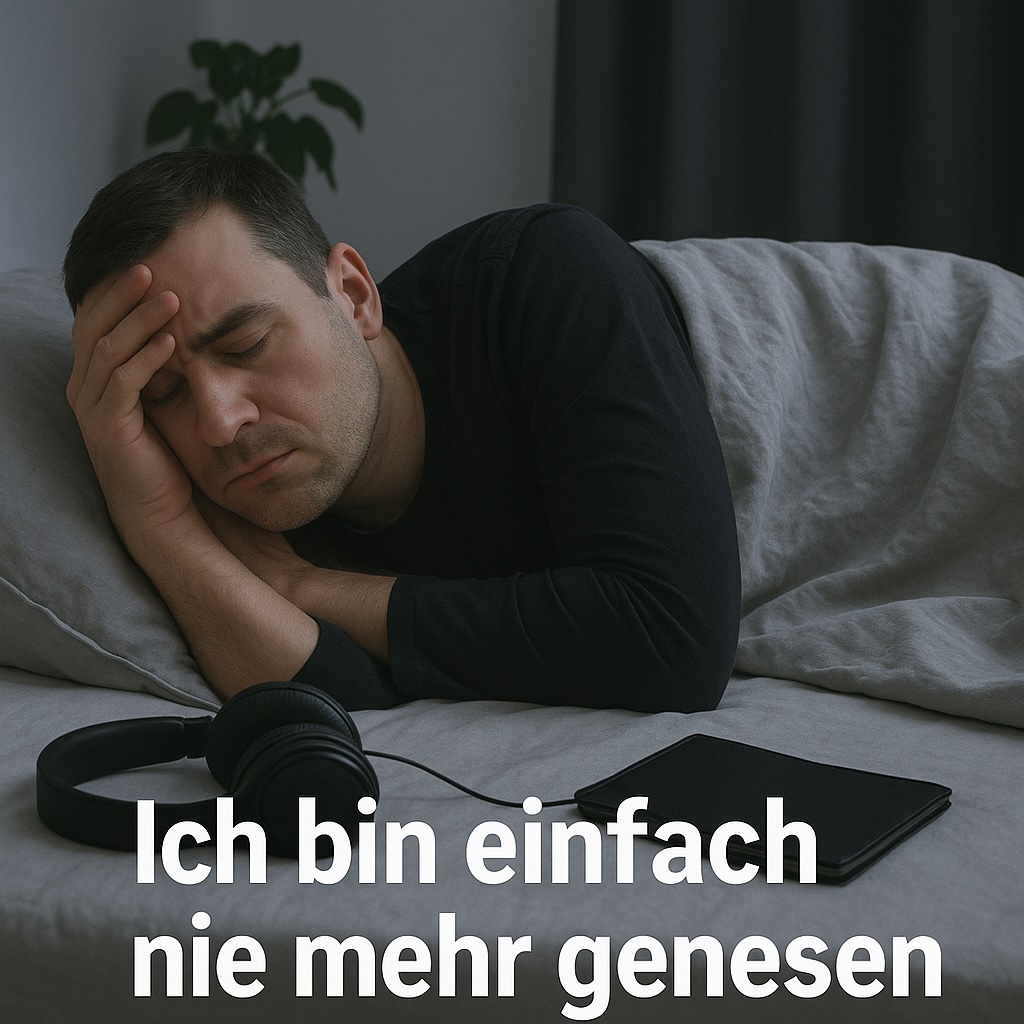
Quelle: KleineZeitung.at
“Ich bin einfach nie mehr genesen” – diese Worte der Journalistin Barbara Wimmer bringen auf den Punkt, was Millionen von Menschen weltweit erleben. Was als vermeintlich harmlose Infektion begann, entwickelte sich zu einer chronischen Erkrankung, die das Leben grundlegend veränderte. Long Covid ist längst nicht mehr nur ein medizinischer Fachbegriff – es ist eine Realität, die zeigt, dass Infektionen weitreichendere Folgen haben können, als wir lange Zeit angenommen haben.
- Mehr als nur Long Covid: Die komplexe Welt der postakuten Infektionssyndrome
- Die Gretchenfrage der Forschung: Was löst diese Syndrome aus?
- ME/CFS: Wenn die Erschöpfung zur Behinderung wird
- Leben mit 40 Prozent Energie: Die Schweizer Realität
- Persönliche Geschichten: Die Kraft des Teilens und der Gemeinschaft
Mehr als nur Long Covid: Die komplexe Welt der postakuten Infektionssyndrome
Long Covid wurde während der Pandemie zu einem weit verbreiteten Begriff, doch das Phänomen persistierender Beschwerden nach Infektionen ist keineswegs neu. Schon lange vor SARS-CoV-2 kannten Mediziner Fälle, in denen Menschen nach viralen Infektionen nicht vollständig genasen. Das Epstein-Barr-Virus, Influenza-Viren oder Enteroviren können ähnliche Langzeitfolgen auslösen. Diese Erkrankungen werden heute unter dem Begriff postakute Infektionssyndrome (PAIS) zusammengefasst.
Was all diese Syndrome gemeinsam haben, ist ihre Komplexität. Über 200 verschiedene Symptome können auftreten – von extremer Erschöpfung über neurologische Beschwerden bis hin zu Herzkreislaufproblemen. Diese Vielfalt macht die Diagnose zu einer Herausforderung und erklärt, warum Betroffene oft jahrelang von Arzt zu Arzt wandern, bevor sie Antworten erhalten. Die Symptome treten bei unterschiedlichen Patienten in verschiedenen Zusammensetzungen sowie Schweregraden auf, was die Medizin vor große Herausforderungen stellt. Man spricht von einer sogenannten Multisystemerkrankung, denn zahlreiche Systeme des Körpers können betroffen sein: Nerven-, Immun- und Herzkreislauf-System.
Barbara Wimmer erhielt ihre Long Covid-Diagnose verhältnismäßig schnell – etwa zwei Monate nach ihrer zweiten COVID-19-Infektion. Doch schnell bedeutet in diesem Kontext immer noch eine Zeit voller Unsicherheit und Symptome, die das tägliche Leben drastisch einschränken. Seit Ende 2023 muss sie mit ihrer Energie haushalten, ihre Tage genau planen und sich vor größeren Terminen schonen – “die Batterie vorsorglich aufladen”, wie sie es beschreibt. Bei Wimmer war es die zweite Covid-19-Infektion, die zu anhaltenden Problemen führte. Schon die akute Phase war extrem herausfordernd, sie musste mit Cortison behandelt werden, da sich die Schleimhäute massiv entzündet hatten. Von dieser Erkrankung hat sie sich bislang nicht erholt.
Die Gretchenfrage der Forschung: Was löst diese Syndrome aus?
Die zentrale Frage, die Forscher weltweit beschäftigt, lautet: Warum entwickeln manche Menschen nach einer Infektion postakute Syndrome, während andere vollständig genesen? Diese Gretchenfrage ist entscheidend, denn nur wenn wir die Entstehungsmechanismen verstehen, können wir wirksame Therapien entwickeln. Verstehen wir den Entstehungsmechanismus, können wir uns daran machen, diesen zu unterbinden. Es ist also jene Forschungsfrage, mit der sich das nationale Referenzzentrum für PAIS beschäftigt.
Das nationale Referenzzentrum für PAIS an der MedUni Wien, geleitet von Kathryn Hoffmann und Eva Untersmayr-Elsenhuber, erforscht verschiedene Hypothesen. Ein vielversprechender Ansatz beschäftigt sich mit Virusresten, die im Darm verbleiben und das Darmmikrobiom sowie das Immunsystem beeinflussen könnten. “Es ist wahrscheinlich so, dass je nach Erreger diese Erkrankung ein bisschen anders anfängt”, erklärt die Ko-Leiterin des Referenzzentrums Kathryn Hoffmann. Eva Untersmayr-Elsenhuber untersucht beispielsweise, inwieweit im Darm verbliebene Virusreste das Darmmikrobiom und in weiterer Folge das Immunsystem triggern. “Wenn wir an Enteroviren denken, die ja auch im Darm ‘beginnen’, wäre das ein Erklärungsansatz”, sagt Hoffmann.
Francisco Westermeier von der FH Joanneum in Graz fokussiert sich auf das Endothel – jene dünne Zellschicht, die das Innere der Blutgefäße auskleidet. Sie ist essenziell für die Regulierung des Blutflusses, der Aufnahme von Sauerstoff und Nährstoffen und den Abtransport von Abfallstoffen. Sind diese Funktionen gestört (endotheliale Dysfunktion), kann es zu zahlreichen Symptomen kommen, die auch bei Long Covid oder ME/CFS auftreten. “Wir versuchen herauszufinden, ob hier ein Zusammenhang besteht”, erklärt Westermeier, der schon seit 2018 mit ME/CFS forscht. Seine Forschung zeigt: Es wird nicht den einen Biomarker geben, der alle Fälle erklärt. “Es handelt sich um eine multisystemische Erkrankung, wir werden diverse Biomarker brauchen.” Auch weil immer klarer wird, dass man die Betroffenen in Untergruppen einteilen und diese genauer analysieren muss, aus mehreren Blickwinkeln, mit Fachleuten unterschiedlicher Bereiche.
ME/CFS: Wenn die Erschöpfung zur Behinderung wird
Die schwerste Form der postakuten Infektionssyndrome trägt den Namen Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom (ME/CFS). Das Kardinalsymptom dieser Erkrankung ist die post-exertionelle Malaise (PEM) – eine anhaltende Verstärkung aller Symptome nach geringer körperlicher oder geistiger Anstrengung. PEM ist mehr als nur normale Erschöpfung. Es ist ein Crash, der Betroffene tagelang oder wochenlang außer Gefecht setzen kann. Das bedeutet: Strengen sich Betroffene zu sehr an, verschlechtert sich ihr Allgemeinzustand nach der Belastung – es kommt zum sogenannten Crash.
Barbara Wimmer erlebte einen solchen Crash, als sie aufgrund eines gesundheitlichen Problems eine Spitalsambulanz aufsuchen musste. Fünf Stunden wartete sie bei grellem Licht und lauten Geräuschen. “Als ich dann dran war, war ich nicht mehr in der Lage zu erklären, wieso ich da war”, schildert sie. Die Tage und Wochen danach musste auch sie in einem abgedunkelten Zimmer verbringen, “ich war reizempfindlich ohne Ende und konnte keine Berührungen mehr ertragen.” Diese extreme Reizempfindlichkeit betrifft alle Sinne: Licht, Geräusche, Berührungen und sogar Gerüche können unerträglich werden. Diese Symptome sind nicht psychosomatisch oder eingebildet – sie sind reale, messbare Folgen einer schwerwiegenden Erkrankung des Nervensystems.
ME/CFS wird in vier Schweregrade eingeteilt, die das Ausmaß der Beeinträchtigung verdeutlichen. Bei der leichten Form ist das Aktivitätslevel um etwa 50 Prozent reduziert. Arbeit oder Ausbildung sind möglich, gehen aber meist zulasten des Soziallebens. Betroffene schränken sich am Wochenende extrem ein, um die Arbeitswoche zu überstehen. Zum Beispiel schränken sich Betroffene am Wochenende extrem ein, um den Rest der Woche funktionieren zu können. Bei der moderaten Form sind weitere Einschränkungen gegeben, oft ist nur noch Teilzeitarbeit oder gar keine Berufstätigkeit mehr möglich. Die schwere Form bedeutet, dass Betroffene überwiegend bettlägerig und auf Hilfe angewiesen sind. Bei der sehr schweren Form herrscht vollständige Pflegebedürftigkeit, extreme Reizempfindlichkeit gegenüber Licht, Geräuschen, Berührungen. Schwerst Betroffene hingegen können sich selbst nicht mehr versorgen, sind auf Hilfe und Pflege angewiesen, ihre Reizempfindlichkeit und Belastungs-Erholungsstörung (PEM) ist so stark ausgeprägt, dass sie praktisch nur in abgedunkelten und stillen Räumen leben können. In Österreich sind laut neuesten Schätzungen des Referenzzentrums 73.600 Personen von ME/CFS betroffen, davon 14.700 schwer oder sehr schwer.
Leben mit 40 Prozent Energie: Die Schweizer Realität
Für Betroffene in der Schweiz stellt sich nicht nur die Frage nach der medizinischen Behandlung, sondern auch nach der gesellschaftlichen und institutionellen Anerkennung ihrer Erkrankung. Long Covid und IV-Anmeldungen zeigen die harte Realität auf, mit der sich Betroffene konfrontiert sehen, wenn sie Unterstützung benötigen. Die Komplexität der Symptome und das Fehlen eindeutiger Biomarker machen es für Betroffene schwierig, ihre Situation zu erklären. Wie erkläre ich meinem Arzt meine Symptome? – diese Frage beschäftigt viele, denn die Kommunikation mit dem medizinischen Fachpersonal ist oft der erste Schritt zu einer angemessenen Versorgung.
Barbara Wimmer hat mittlerweile das Glück, bei zwei der wenigen Ärzte in Behandlung zu sein, die sich mit diesem Krankheitsbild auskennen. 40 Prozent ihres ursprünglichen Energieniveaus stehen ihr zur Verfügung – das reicht nicht für ein normales Leben. Eine Stunde Arbeit am Tag ist möglich, Freunde treffen funktioniert nur mit sorgfältiger Planung, Spontanität ist praktisch unmöglich. Zu ihrem Geburtstag gönnte sie sich den “Luxus”, auswärts zu essen: “Ein Ausflug in einem klimatisierten Leihauto, 40 Minuten Fahrzeit, eine Stunde essen, wieder zurückfahren. Das geht gerade einmal zu meinem Geburtstag.”
Diese Schilderung macht deutlich, was ein Leben mit schweren postakuten Infektionssyndromen bedeutet. Jede Aktivität muss abgewogen, jede Energie eingeteilt werden. Long Covid verstehen und bewältigen wird zu einer täglichen Aufgabe, die weit über medizinische Behandlung hinausgeht. Es bedeutet, das Leben komplett neu zu strukturieren, Prioritäten zu setzen und zu akzeptieren, dass vieles, was früher selbstverständlich war, nun unmöglich geworden ist.
Eines der größten Probleme bei postakuten Infektionssyndromen ist ihre Unsichtbarkeit. Betroffene sehen oft gesund aus, was zu Missverständnissen und mangelndem Verständnis in ihrem Umfeld führt. ME/CFS kurz erklärt: Erschöpft nach der Infektion kann helfen, Angehörigen und Freunden die Komplexität dieser Erkrankungen zu vermitteln. Diese Unsichtbarkeit führt oft zu sozialer Isolation, da Betroffene ihre Teilnahme an gesellschaftlichen Ereignissen drastisch reduzieren müssen, aber von außen nicht krank aussehen.
Die Forschung zu postakuten Infektionssyndromen steht noch am Anfang, macht aber Fortschritte. Verschiedene Hypothesen werden verfolgt: Bei einer Untergruppe der Betroffenen ist das Immunsystem aus der Bahn geworfen, hier spielen vor allem die Mastzellen eine Rolle, die auch bei Allergien oder Unverträglichkeiten beteiligt sind. Manche Betroffene haben mehr mit dem Gefäßsystem zu kämpfen, es bilden sich Minithrombosen, die vor allem die feinen Blutgefäße verstopfen und so den Sauerstoffkreislauf behindern. Verbliebene Virusreste im Darm könnten das Mikrobiom und das Immunsystem beeinflussen. Störungen der Blutgefäß-Innenwände können zu vielen der beobachteten Symptome führen.
Die Vielfalt der Forschungsansätze zeigt: Es wird wahrscheinlich nicht die eine Ursache und die eine Behandlung geben. Stattdessen müssen Betroffene in Untergruppen eingeteilt und individuell behandelt werden. Die Forschung zu postakuten Infektionssyndromen hat durch Long Covid einen enormen Schub erhalten. Gelder fließen in Projekte, die lange unterfinanziert waren. Die “We & Me”-Stiftung schrieb beispielsweise in Kooperation mit dem österreichischen Wissenschaftsfonds FWF einen internationalen Förderpreis aus, der mit 450.000 Euro dotiert ist. Zwei von drei Söhnen der Familie Stöck sind ebenfalls an ME/CFS erkrankt, was zeigt, dass diese Erkrankung alle Gesellschaftsschichten betreffen kann.
Persönliche Geschichten: Die Kraft des Teilens und der Gemeinschaft
Barbara Wimmers Geschichte ist nur eine von vielen. Hinter jeder Diagnose steht ein Mensch mit einer einzigartigen Geschichte – von den ersten rätselhaften Symptomen über die oft lange Odyssey zur Diagnose bis hin zum Umgang mit der neuen Realität. Diese persönlichen Erfahrungen sind nicht nur für andere Betroffene wertvoll, sondern helfen auch dabei, das Bewusstsein für postakute Infektionssyndrome zu schärfen. Unsere Sammlung persönlicher Geschichten zeigt die ganze Bandbreite der Erfahrungen: Von Menschen, die nach einer milden COVID-Infektion plötzlich ihr Leben komplett umstellen mussten, bis hin zu jenen, die nach anderen Infektionen an ME/CFS erkrankten. Jede Geschichte ist anders, und doch gibt es so viele Gemeinsamkeiten – die Unsicherheit in der Anfangszeit, der Kampf um Verständnis, die kleinen Siege im Umgang mit der Krankheit.
Diese Geschichten machen Mut, zeigen Lösungsansätze auf und verdeutlichen vor allem: Du bist wirklich nicht allein. Sie helfen anderen Betroffenen zu verstehen, dass ihre Erfahrungen geteilt werden, und sie geben Angehörigen Einblicke in eine Welt, die sonst schwer zu verstehen ist. Wenn du selbst von Long Covid, ME/CFS oder anderen postakuten Infektionssyndromen betroffen bist, laden wir dich herzlich ein, deine Geschichte zu teilen. Das Erzählen der eigenen Erfahrungen kann heilsam sein – es hilft dabei, das Erlebte zu verarbeiten und ihm einen Sinn zu geben. Gleichzeitig hilfst du anderen Betroffenen, sich weniger isoliert zu fühlen, und trägst dazu bei, das Verständnis für diese komplexen Erkrankungen zu verbessern.
Deine Geschichte muss nicht perfekt formuliert oder besonders dramatisch sein. Jede Erfahrung ist wertvoll – ob du gerade erst die ersten Symptome bemerkst, mitten im Diagnoseprozess steckst oder schon länger mit der Erkrankung lebst. Auch positive Entwicklungen, erfolgreiche Bewältigungsstrategien oder einfach nur der ehrliche Einblick in deinen Alltag können für andere von unschätzbarem Wert sein. Auf ichbinkeineinzelfall.ch/persoenliche-geschichten findest du sowohl inspirierende Berichte anderer Betroffener als auch die Möglichkeit, deine eigene Geschichte beizutragen.
Angesichts der Komplexität und der oft langen Wege zur Diagnose ist der Austausch mit anderen Betroffenen von unschätzbarem Wert. Gemeinsame Erfahrungen, praktische Tipps und emotionale Unterstützung können den Unterschied machen zwischen Isolation und dem Gefühl, verstanden zu werden. Bei ichbinkeineinzelfall.ch haben wir eine Gemeinschaft geschaffen, in der sich Betroffene austauschen, gegenseitig unterstützen und gemeinsam für mehr Verständnis und bessere Versorgung einsetzen können. Unsere Mitgliedschaftsoptionen bieten verschiedene Möglichkeiten, Teil dieser wichtigen Community zu werden und gleichzeitig die Arbeit für mehr Aufklärung und Unterstützung zu stärken.
Doch auch wenn die Forschung voranschreitet, braucht es Zeit bis zu wirksamen Therapien. Für die Menschen, die heute unter postakuten Infektionssyndromen leiden, ist das wichtigste die Anerkennung ihrer Erkrankung und die bestmögliche symptomatische Behandlung. Die Geschichte von Barbara Wimmer und Millionen anderer Betroffener weltweit zeigt uns: Infektionen sind nicht immer harmlos. Sie können Leben grundlegend verändern. Diese Erkenntnis sollte uns nicht in Angst versetzen, sondern zu mehr Respekt vor Krankheitserregern und mehr Verständnis für Betroffene führen.
Postakute Infektionssyndrome sind keine seltenen Exoten – sie betreffen einen signifikanten Teil der Bevölkerung. ME/CFS allein betrifft schätzungsweise 17 Millionen Menschen weltweit. Diese Menschen brauchen unsere Unterstützung, unser Verständnis und vor allem: Sie brauchen, dass wir ihre Erkrankung ernst nehmen. Wenn du selbst betroffen bist, weißt du, wie wichtig es ist, nicht allein zu sein. Wenn du Angehöriger oder Freund eines Betroffenen bist, kannst du durch Verständnis und Unterstützung einen enormen Unterschied machen. Und wenn du bisher verschont geblieben bist, dann hilf mit, das Bewusstsein für diese unsichtbaren Krankheiten zu schärfen.
Die Worte “Ich bin einfach nie mehr genesen” müssen nicht das Ende der Geschichte sein. Mit mehr Forschung, besserem Verständnis und solidarischer Unterstützung können wir dafür sorgen, dass Betroffene die Hilfe bekommen, die sie brauchen, und dass zukünftig weniger Menschen diesen schweren Weg gehen müssen. Bei ichbinkeineinzelfall.ch stehen wir für genau diese Solidarität. Wir zeigen: Du bist nicht allein mit deiner Erkrankung. Gemeinsam sind wir stärker, gemeinsam können wir etwas bewegen. Gemeinsam schaffen wir ein Netzwerk der Unterstützung und des Verständnisses. Denn tatsächlich: Du bist kein Einzelfall.
Dieser Artikel basiert teilweise auf Berichten und Forschungsergebnissen aus Österreich und Deutschland. Die medizinischen Informationen ersetzen nicht die professionelle Beratung durch einen Arzt. Bei anhaltenden gesundheitlichen Problemen wenden Sie sich bitte an einen Mediziner.

