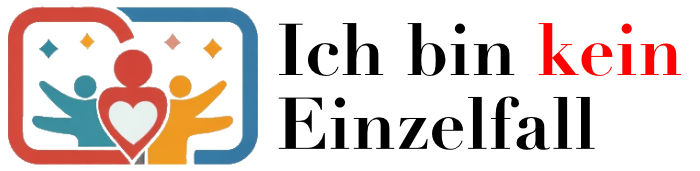Long Covid – das anhaltende Leiden nach einer COVID-19-Infektion – hat sich zu einer neuen Volkskrankheit entwickelt. Alleine in der Schweiz sind schätzungsweise 300’000 Menschen betroffen, etwa jede 30. Person . Die Bandbreite der Symptome ist enorm: Über 200 verschiedene Beschwerden wurden weltweit dokumentiert , von chronischer Erschöpfung und „Gehirnnebel“ bis hin zu Atemproblemen, Herzrasen oder Geruchsverlust. Long Covid betrifft Menschen jeden Alters – zuvor Gesunde ebenso wie Vorerkrankte – und stellt Betroffene, Ärztinnen und Ärzte sowie das Gesundheitssystem vor immense Herausforderungen. Dieser Artikel beleuchtet den aktuellen Stand der Forschung, typische Symptome, mögliche Behandlungen und insbesondere die Situation in der Schweiz – von bürokratischen Hürden bis zu den sozialen und emotionalen Aspekten, die Long-Covid-Patienten und ihr Umfeld prägen.
- Aktueller Stand der Forschung zu Long Covid
- Symptome: Häufige Beschwerden, seltenere Zeichen und Alltagseinfluss
- Behandlungsmöglichkeiten: Schulmedizinische und alternative Ansätze
- Schulmedizinische Behandlungen:
- Off-Label-Therapien und alternative Ansätze:
- Hürden bei Off-Label-Therapien:
- Institutionelle Herausforderungen in der Schweiz: IV und Krankenkassen
- Soziale und emotionale Aspekte: Verzweiflung, Hoffnung und die Suche nach Lösungen
- Die Frage nach dem Wert eines Menschenlebens
- Und was heisst das alles nun für Betroffene?
Aktueller Stand der Forschung zu Long Covid
Weltweit wird fieberhaft daran geforscht, warum manche Menschen Wochen und Monate nach einer Coronavirus-Infektion nicht gesund werden. Mittlerweile geht man davon aus, dass Long Covid ein komplexes Syndrom mit mehreren Ursachen ist . Die Forschung hat bereits einige Mechanismen identifiziert, die zur Krankheit beitragen könnten:
• Anhaltende Entzündungen und Mikrogerinnsel: Bei vielen Long-Covid-Patienten zeigen sich Mikroklumpen im Blut (sogenannte Mikrogerinnsel), die in dieser Form bei Gesunden kaum auftreten . Diese winzigen Blutgerinnsel können die Durchblutung von Organen beeinträchtigen. Forscher vermuten, dass sie zu Symptomen wie extremer Müdigkeit, Brustschmerzen oder kognitiven Störungen beitragen, da Gewebe und Gehirn nicht optimal mit Sauerstoff versorgt werden.
• Autoimmunreaktionen: Ein weiterer wichtiger Ansatz ist die Autoimmun-Hypothese. Dabei richtet sich das Immunsystem nach der Infektion gegen körpereigene Strukturen. Eine aktuelle Studie untermauert diese Theorie: Injektionen von Antikörpern aus dem Blut von Long-Covid-Patienten führten bei gesunden Mäusen zu Long-Covid-ähnlichen Symptomen wie verstärkter Schmerzempfindung und Schwindel . Erstmals konnte so ein kausaler Zusammenhang zwischen den Autoantikörpern der Patienten und ihren Symptomen gezeigt werden. Dies legt nahe, dass Autoantikörper – vom eigenen Körper gebildete Abwehrstoffe – an den anhaltenden Beschwerden beteiligt sind.
• Viruspersistenz: Ebenfalls diskutiert wird, dass das Coronavirus selbst im Körper verbleiben und schwelende Infektionen verursachen könnte. Versteckte Virusreservoire – etwa in Darm, Nervenzellen oder Gewebe – könnten das Immunsystem ständig reizen. Um diese „Virus-These“ zu prüfen, laufen bereits Studien: So testet eine US-Studie der Yale-Universität, ob das antivirale Medikament Paxlovid Long-Covid-Symptome lindern kann . Die Idee dahinter: Falls noch Virusreste die Beschwerden antreiben, müsste eine antivirale Therapie helfen.
• Gestörte Hirnfunktionen: Besonders neurologische Symptome wie Konzentrationsstörungen (Brain Fog) gaben Rätsel auf. Im Februar 2024 präsentierte ein irisches Forscherteam erstmals einen konkreten Auslöser für den Brain Fog: Bei Long Covid ist offenbar die Blut-Hirn-Schranke gestört . Normalerweise schützen dichte Gefäßwände im Gehirn das Nervensystem vor Schadstoffen. Bei Long-Covid-Patienten fanden die Wissenschaftler undichte Blutgefäße im Gehirn sowie ein überaktives Immunsystem, was in Kombination zu Entzündungen und „Gehirnnebel“ führt . Ein Markerprotein (S100-Beta) für eine geschädigte Blut-Hirn-Schranke war bei Betroffenen deutlich erhöht . Diese Entdeckung liefert einen greifbaren Beweis, dass Long Covid körperliche Ursachen hat und etwa kognitive Symptome nicht „eingebildet“ sind, sondern auf messbaren neuronalen Veränderungen basieren.
Die genannten Mechanismen – Gerinnsel, Autoimmunprozesse, Virusreste, neurologische Entzündungen – müssen nicht isoliert auftreten. Wahrscheinlich greifen mehrere Faktoren ineinander, je nach Patient unterschiedlich. Long Covid überschneidet sich in vielen Aspekten mit anderen postviralen Syndromen wie ME/CFS (Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom) oder POTS (Posturales Tachykardie-Syndrom) . Diese Gemeinsamkeiten helfen der Forschung, bekannte Ansätze aus diesen Bereichen zu nutzen. Trotz großer Fortschritte gibt es aber noch keine endgültigen Antworten. Nach wie vor gilt Long Covid als ernstes, aber wenig verstandenes Krankheitsbild, für das es bislang weder einen eindeutigen Labortest noch eine spezifische Heilung gibt . Unternehmen wie Roche arbeiten an biomarkerbasierten Tests zur Diagnose , doch derzeit stützen sich Ärzte auf das Ausschlussverfahren und die genaue Erhebung der Symptome.
Symptome: Häufige Beschwerden, seltenere Zeichen und Alltagseinfluss
Was macht Long Covid mit den Betroffenen? Die Symptome können von Kopf bis Fuß reichen und verschiedenste Organsysteme betreffen. Am häufigsten klagen Long-Covid-Patienten über:
• Fatigue (chronische Erschöpfung): Eine allumfassende Müdigkeit, die durch Schlaf nicht besser wird. Viele fühlen sich, als hätten sie „einen schweren Marathon ohne Training absolviert“. Diese Fatigue geht oft mit Belastungsintoleranzeinher – schon geringe Anstrengungen lassen die Patienten förmlich zusammenklappen. In einer Schweizer Analyse litten viele Long-Covid-Betroffene an Fatigue und waren „chronisch müde und sehr schnell erschöpft“ . Typisch ist das Phänomen der Post-Exertional Malaise (PEM): Nach körperlicher oder mentaler Überanstrengung kommt es zu einem Crash – einer drastischen Verschlechterung des Zustands über Tage oder Wochen . Ein Betroffener berichtet: „Jedes Mal, wenn sich Céline körperlich anstrengte, ging es ihr mehrere Tage hundeelend.“ Diese extreme Empfindlichkeit auf Belastung macht Alltägliches wie Duschen, Einkaufen oder Spazierengehen für viele nahezu unmöglich.
• Kognitive Störungen („Brain Fog“): Konzentrationsprobleme, Wortfindungsstörungen, Gedächtnislücken – viele fühlen sich wie in Watte gepackt. In der IV-Statistik gaben rund 60% der Long-Covid-Antragstellenden an, unter Konzentrations- oder Merkfähigkeitsstörungen zu leiden . Aufgaben, die früher leicht fielen, werden zur Herausforderung: ein Buch lesen, ein Gespräch folgen oder am Computer arbeiten strengt enorm an. Dieser “Gehirnnebel” ist nicht nur lästig, sondern kann die Arbeitsfähigkeit massiv einschränken.
• Atemwegs- und Herzprobleme: Anhaltende Atemnot bei kleinster Belastung, Engegefühl in der Brust oder hartnäckiger Husten kommen insbesondere bei jenen vor, die schwer an Covid-19 erkrankt waren. Aber auch vormals milde Infektionen können zu einem Gefühl führen, „nicht mehr genug Luft zu bekommen“. Einige Betroffene entwickeln Herzrasen (Tachykardie), Herzstolpern oder Blutdruckschwankungen, teils im Rahmen von POTS, was zu Schwindel und Ohnmachtsgefühlen führen kann.
• Schmerzsyndrome: Viele leiden an Kopf-, Muskel- oder Gelenkschmerzen, die neu auftreten oder lange nach der Infektion bleiben. Nervenschmerzen, Kribbeln in Extremitäten oder ein „Brennen“ im Körper wurden ebenfalls berichtet. Manchmal verschlimmern sich vorbestehende chronische Schmerzen nach Covid.
• Schlafstörungen und psychische Symptome: Durch die ständige Erschöpfung ist der Schlaf oft un-erholsam. Hinzu kommen Einschlaf- oder Durchschlafstörungen. Auf Dauer entwickeln manche Depressionen oder Angstzustände, was angesichts der Lebensveränderung durch Long Covid nicht überraschend ist. Wichtig: Diese psychischen Symptomesind meist Folge der körperlichen Krankheit, nicht deren Ursache – dennoch brauchen sie Beachtung und Behandlung.
Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere Symptome: Magen-Darm-Beschwerden (Übelkeit, Durchfall), Verlust oder Verzerrung von Geruchs- und Geschmackssinn, Hautausschläge, Haarverlust, Menstruationsstörungen, Augenprobleme, Tinnitus und vieles mehr. Jeder Patientin hat sein eigenes Symptomprofil, was die Diagnose so schwierig macht. Gemeinsam ist jedoch die Belastung im Alltag: Neun von zehn in der erwähnten Schweizer IV-Analyse waren wegen ihrer Long-Covid-Symptome voll arbeitsunfähig krankgeschrieben . Selbst Routineaufgaben – vom Kochen über Kinderbetreuung bis zum Treppensteigen – können zur unüberwindbaren Hürde werden. Viele Betroffene müssen ihre Arbeitszeit reduzieren oder ganz kündigen, was finanzielle Sorgen nach sich zieht. Zwei Drittel der Long-Covid-Betroffenen in der IV-Studie waren übrigens Frauen , was Fragen nach hormonellen oder immunologischen Unterschieden aufwirft. Klar ist: Long Covid kann ein zuvor aktives Leben völlig aus der Bahn werfen.
Der Krankheitsverlauf ist individuell. Einige Menschen erholen sich innerhalb von wenigen Monaten wieder vollständig. Etwa 60% der IV-Antragsteller verbesserten ihre Arbeitsfähigkeit in den ersten zwei Jahren nach Anmeldung – ein Hoffnungsschimmer. Andere hingegen kämpfen auch nach zwei oder mehr Jahren noch mit schweren Symptomen. Verbesserungen treten laut Experten oft entweder früh ein – oder sehr lange kaum noch . Viele erleben zudem wellenförmige Verläufe: Phasen besserer Tage wechseln sich mit Rückfällen ab. Diese Unberechenbarkeit erschwert die Lebensplanung enorm. Manche Patienten erholen sich nie komplett und müssen ihr Leben dauerhaft an die reduzierte Belastbarkeit anpassen.
Behandlungsmöglichkeiten: Schulmedizinische und alternative Ansätze
Die Medizin steht bei Long Covid vor der Herausforderung, eine völlig neue Krankheit behandeln zu müssen – ohne etablierte Therapien oder Medikamente mit klarer Wirksamkeit. Aktuell gibt es kein standardisiertes Heilmittel; die Behandlung richtet sich nach den Symptomen und erfolgt oft nach dem Prinzip „Try and Error“. Dennoch haben sich einige Ansätze herauskristallisiert:
Schulmedizinische Behandlungen:
In vielen Schweizer Spitälern und Reha-Kliniken wurden Long-Covid-Sprechstunden oder -Programme eingerichtet. Hier steht meist ein multidisziplinärer Ansatz im Vordergrund: Ärztinnen verschiedener Fachrichtungen, Physio- und Ergotherapeuten, Psychologen und Sozialberater arbeiten zusammen. Typische Elemente sind:
• Rehabilitation und Physio-/Ergotherapie: Je nach Beschwerden wird versucht, die körperliche Leistungsfähigkeit schrittweise zu steigern – allerdings mit Vorsicht. Überanstrengung soll vermieden werden, da sie Patienten zurückwerfen kann . Statt klassischer „Aufbautraining“ setzt man vermehrt auf Pacing, also das dosierte Einteilen von Kräften. Patienten lernen, ihre Herzfrequenz oder Symptome im Blick zu behalten und Aktivitätspausen einzulegen, bevor die Erschöpfung sie überwältigt.
• Symptomatische Medikamente: Gegen einzelne Symptome kommen bereits bekannte Medikamente zum Einsatz – oft off-label, d.h. außerhalb ihrer eigentlichen Zulassung. Beispielsweise erhalten manche Patienten mit Herzrasen Beta-Blocker, mit Nervenschmerzen Gabapentin, mit starkem Schlaflosigkeit low-dose Antidepressiva etc. Bei Atembeschwerden helfen Inhalationen oder Asthma-Sprays. Kortison oder entzündungshemmende Mittel werden vereinzelt getestet, ebenso Antihistaminika bei Verdacht auf Mastzellaktivierung. Standard ist dies aber nicht, da robuste Belege fehlen.
• Psychologische und soziale Unterstützung: Psychoedukation, Entspannungstechniken und bei Bedarf Psychotherapie helfen, mit der Krankheit umzugehen. Wichtig ist auch die soziale Beratung, z.B. beim Berufs-Wiedereinstieg oder bezüglich IV-Anmeldung (dazu später mehr).
Off-Label-Therapien und alternative Ansätze:
Mangels durchschlagender schulmedizinischer Lösungen suchen viele Betroffene nach innovativen oder experimentellen Therapien. Zwei davon sorgen derzeit für viel Gesprächsstoff – auch in der Schweiz:
• Nikotinpflaster: Was zunächst skurril klingt, hat einen wissenschaftlichen Hintergrund. Früh in der Pandemie fiel auf, dass überraschend wenige Raucher schwer an Covid erkrankten – eine Beobachtung, die zur „Nikotinhypothese“ führte . Man vermutete, dass Nikotin an bestimmten Rezeptoren (den nicotinischen Acetylcholin-Rezeptoren) andockt und so vielleicht schädliche Prozesse des Virus blockieren könnte . Im Fall von Long Covid leidet möglicherweise die Signalübertragung im Nervensystem durch das Virus . Erste Experimente mit Nikotinpflastern waren tatsächlich vielversprechend: In einer kleinen Fallstudie mit 4 Long-Covid-Patienten verbesserten sich bei allen vieren die Symptome spürbar und schnell , als sie täglich ein Nikotinpflaster nutzten. Dabei reichte meist schon die niedrigste Dosis (7 mg/24h). Diese Ergebnisse haben natürlich Grenzen – es war keine kontrollierte Studie mit Placebo . Trotzdem wecken sie Hoffnung, dass Nikotin (ohne die Giftstoffe des Tabakrauchs) gewisse Long-Covid-Mechanismen beeinflussen kann. Größere klinische Studien stehen noch aus . Dennoch tauschen sich Betroffene bereits über ihre Erfahrungen mit rezeptfreien Nikotinpflastern aus. Ärzte warnen aber: Nikotin macht abhängig und ist keine ungefährliche Substanz, daher sollte ein solcher Therapieversuch nur in Rücksprache mit Medizinern erfolgen.
• Blutwäsche (Apherese): Die H.E.L.P.-Apherese – eine Form der Blutreinigung – hat in den letzten zwei Jahren bei Long Covid Schlagzeilen gemacht. Dabei wird das Blut außerhalb des Körpers durch Filter und Chemikalien von bestimmten Bestandteilen gereinigt (z.B. Gerinnungsfaktoren, entzündlichen Stoffen) und dann zurückgeführt . Die Idee dahinter: Long Covid könnte durch schädliche Partikel im Blut (wie Mikrogerinnsel oder Autoantikörper) unterhalten werden. Wenn man diese entfernt, bessern sich die Symptome. Tatsächlich berichten einige Patienten von deutlichen Verbesserungen nach Apherese, während andere keine Veränderung spüren . Wissenschaftliche Belege fehlen bislang. Keine einzige unabhängige Studie konnte die Wirksamkeit dieser teuren Therapie eindeutig nachweisen . In Zürich wollten zwei Ärzte eine placebokontrollierte Studie mit 140 Patienten durchführen, um die Wirkung objektiv zu prüfen – das Projekt scheiterte jedoch mangels Finanzierung . Trotz dieser Unsicherheit klammern sich schwer Betroffene an solche Optionen, gerade wenn sonst nichts hilft. Célines Familie z.B. setzt große Hoffnung auf die Blutwäsche, nachdem die gängigen Therapien versagten .
• Weitere Ansätze: Daneben kursieren zahlreiche andere Therapiemethoden – von Vitamin- und Nährstoffinfusionen(z.B. hochdosiertes Vitamin B12) über Hyperbarkammer-Behandlungen (Sauerstoff-Therapie) bis hin zu traditioneller chinesischer Medizin oder Ernährungsumstellungen (antientzündliche Diäten). Auch Physiospezialmethoden (wie Atemtherapie nach Buteyko) und Neuromodulationstechniken (z.B. Vagusnerv-Stimulation) werden ausprobiert. Die Evidenz hierfür ist meist anekdotisch. Viele Betroffene probieren verschiedene Dinge aus in der Hoffnung, irgendetwasmöge anschlagen.
Hürden bei Off-Label-Therapien:
Problematisch ist, dass unkonventionelle Behandlungen oft nicht von Krankenkassen bezahlt werden. Die Schweizer Krankenkassen berufen sich auf das Gesetz, wonach „unwirksame, unzweckmässige oder unwirtschaftliche“Therapien nicht übernommen werden müssen . Da für neuartige Long-Covid-Therapien Wirksamkeitsnachweise fehlen, gelten sie als „unwirksam“ im Sinne des Gesetzes – selbst wenn Einzelfälle Erfolge zeigen. So wurden z.B. Kosten von rund 20’000 Franken für 9 Apherese-Sitzungen von der Kasse Helsana verweigert . Viele Patienten stehen somit vor dem Dilemma, entweder selbst tief in die Tasche zu greifen oder die Therapie bleiben zu lassen. Célines Familie sah sich gezwungen, einen Spendenaufruf zu starten, um die ca. 30’000 Franken für die Blutwäsche und Nebenkosten aufzubringen . Für die meisten Menschen ist das nicht machbar – es entsteht eine Zweiklassen-Situation, in der wohlhabendere Kranke eher Zugang zu experimentellen Behandlungen haben als finanziell Schwächere.
Allerdings gab es in der Schweiz jüngst ein wegweisendes Gerichtsurteil: Im Mai 2024 entschied das Bundesgericht, dass die Helsana im obigen Fall die Apherese-Kosten doch übernehmen muss . Die Begründung: Der Versicherer konnte nicht beweisen, dass die Therapie unwirksam ist, da es schlicht zu wenig wissenschaftliche Daten gibt . Dieses Urteil stellt die übliche Praxis auf den Kopf – normalerweise muss der Patient die Wirksamkeit belegen, nicht die Kasse die Unwirksamkeit. Experten sehen hier einen potentiellen Präzedenzfall, der Versicherungen zukünftig zwingen könnte, auch unbewiesene Therapien zu bezahlen, solange ein Arzt sie verordnet . Die Versicherungen kritisieren das scharf: Man fürchtet, dass dadurch Kosten und Prämien steigen, wenn nun öfter teure Experimentalterapien finanziert werden müssten . Für Betroffene hingegen ist dieser Entscheid ein Lichtblick – er gibt Hoffnung, dass notwendige Behandlungen im Zweifel bezahlt werden, statt Menschen aus Kostengründen im Stich zu lassen.
Institutionelle Herausforderungen in der Schweiz: IV und Krankenkassen
Long Covid stellt nicht nur die Medizin vor neue Fragen, sondern auch die Sozialversicherungen. In der Schweiz ringen viele Betroffene mit der Invalidenversicherung (IV) und den Krankenkassen um Unterstützung. Es zeigt sich, dass unser System auf eine derartige Langzeiterkrankung nur bedingt vorbereitet ist.
Ein Blick auf die Zahlen: Laut einer Studie im Auftrag des Bundesamts für Sozialversicherungen machten Long-Covid-Fälle rund 2% aller neuen IV-Anmeldungen in den Jahren 2021–2023 aus . Etwa 2’900 Long-Covid-Patientenmeldeten sich in diesem Zeitraum bei der IV; neun von zehn waren zunächst voll arbeitsunfähig geschrieben . Das BSV schreibt, Long Covid sei für die IV ein „neues, ernstzunehmendes Krankheitsbild mit häufig drastischen Auswirkungen für die Betroffenen“ . Folglich mussten die IV-Stellen aufwendige Abklärungen durchführen, oft mit ungewissem Ausgang .
Die IV verfolgt das Prinzip „Eingliederung vor Rente“ . Das heißt, bevor jemand eine IV-Rente erhält, wird geprüft, ob mit Eingliederungsmaßnahmen (etwa berufliche Umschulungen, Anpassungen am Arbeitsplatz, medizinische Reha) eine Rückkehr ins Erwerbsleben möglich ist . Bei Long Covid stieß dieses Vorgehen teils an Grenzen: Wie soll man jemanden umschulen, der kaum 30 Minuten am Stück konzentriert sitzen kann? Oder jemanden eingliedern, dessen Gesundheitszustand von Tag zu Tag schwankt? Viele Long-Covid-Betroffene berichten von einem Spießrutenlauf: Sie müssen in Begutachtungen immer wieder erklären, was Long Covid ist, dass ihre Beschwerden real und nicht „psychosomatisch“ sind, und warum sie momentan nicht arbeiten können. Objektive Befunde (wie ein auffälliger Laborwert oder MRI) fehlen oft, was es schwieriger macht, die IV von der Schwere der Erkrankung zu überzeugen.
Die Entscheidungsprozesse ziehen sich entsprechend hin. Im Fall der 23-jährigen Céline etwa „zieht und zieht sich“ die IV-Rentenprüfung – über zwei Jahre nach Krankheitsbeginn war noch kein Bescheid gefällt . Solange erhalten Betroffene allenfalls eine Krankentaggeld-Versicherung (falls vorhanden) oder Arbeitslosenhilfe, doch diese laufen irgendwann aus. Célines Krankentaggeld endete nach zwei Jahren, und von der IV bekam sie zunächst nur eine Hilflosenentschädigung (für die intensive Pflege zuhause) . Viele geraten in dieser Warteschleife in finanzielle Not, da Ersparnisse aufgebraucht werden und unklar ist, ob und wann eine Rente kommt.
Selbst wenn eine IV-Rente zugesprochen wird, ist die Lage nicht rosig: Ende 2023 erhielten etwa 12% der Long-Covid-Betroffenen, die sich 2021/22 bei der IV angemeldet hatten, eine Rente . Zum Vergleich: In einer Kontrollgruppe (andere Krankheiten) waren es 9%. Die Quote ist also etwas höher, zeigt aber auch, dass die Mehrheit keine Rentebekam – teils weil sie sich glücklicherweise erholt haben, teils weil die Verfahren noch laufen oder abgelehnt wurden . In Fällen, wo laut IV „kein Eingliederungspotenzial“ besteht, sind die Voraussetzungen für eine Rente trotzdem nicht immer erfüllt . Das deutet darauf hin, dass manche Anträge abgelehnt wurden, obwohl die Personen nicht mehr arbeitsfähig sind – eventuell mit Verweis auf unklare Befundlage oder weil die IV die Langzeitprognose anders einschätzt.
Auch die Krankenkassen sind herausgefordert. Sie müssen entscheiden, welche Behandlungen sie bezahlen (siehe voriges Kapitel zu Off-Label-Therapien) und wie lange eine Person als „krank“ gilt. In der Schweiz sind Arbeitgeber verpflichtet, den Lohn eine gewisse Zeit weiterzuzahlen, und viele haben Taggeldversicherungen – aber all das ist befristet (oft 1–2 Jahre). Danach bleiben Kranke ohne IV-Rente praktisch ohne Einkommen. Gleichzeitig verursachen Long-Covid-Patienten hohe Gesundheitskosten: viele Arztbesuche, Therapien, Medikamente. Kassen prüfen daher genau, was erstattet wird. Die Apherese und andere neue Therapien wurden zunächst konsequent abgelehnt mit Verweis auf fehlende Wirksamkeit . Das Bundesgerichtsurteil könnte hier etwas Entlastung für Patienten bringen, ist aber noch frisch und seine Auslegung offen.
Eine weitere Hürde ist die medizinische Versorgung selbst. Trotz spezieller Long-Covid-Ambulanzen gibt es Berichte von Überlastung. Ein krasses Beispiel lieferte das Kantonsspital Graubünden in Chur: Dort wurde Anfang 2024 die Long-Covid-Sprechstunde abrupt eingestellt, weil das Team personell am Limit war . „Von heute auf morgen fehlt den Betroffenen eine Anlaufstelle“, schrieb die Presse . Rund 100 Patienten standen plötzlich ohne Betreuung da. Eine Betroffene schilderte verzweifelt: „Wohin soll ich mich wenden, wer hilft mir nun weiter?“ . Solche Fälle zeigen, dass selbst engagierte Kliniken an ihre Grenzen kommen – personell, finanziell oder emotional. Long Covid erfordert zeitintensive Betreuung, für die im getakteten Klinikalltag oft kein Platz ist. Experten fordern daher mehr dauerhafte Strukturen: spezialisierte Zentren, Forschungsgelder, Schulung von Hausärzten, damit Betroffene nicht wie heimatlose Patienten umherirren.
Soziale und emotionale Aspekte: Verzweiflung, Hoffnung und die Suche nach Lösungen
Hinter den medizinischen Fakten und bürokratischen Kämpfen stehen Menschen, deren Leben auf den Kopf gestellt wurde. Long Covid ist nicht nur eine körperliche Belastung, sondern auch eine seelische Zerreißprobe – für Betroffene und ihr Umfeld.
Für die Erkrankten selbst bedeutet Long Covid häufig den Verlust des alten Lebens. Nichts ist mehr wie zuvor: Gesundheit, Leistungsfähigkeit, oft auch der Job und die finanzielle Sicherheit – all das ist weg oder bedroht. „Céline hat alles verloren“, bringt es der Vater einer 23-jährigen Patientin auf den Punkt . Die junge Frau war zuvor kerngesund, stand mitten im Leben, und ist nun bettlägerig und pflegebedürftig . Ihr Freund konnte die Situation nicht verkraften und trennte sich . Freunde und Familie ziehen sich mitunter zurück, sei es aus Überforderung oder weil sie die unsichtbare Krankheit nicht verstehen. Viele Long-Covid-Kranke fühlen sich isoliert und missverstanden. Wo anfangs vielleicht noch Mitgefühl herrschte („Du wirst schon wieder auf die Beine kommen“), schlägt nach Monaten der Stagnation manchmal Ungeduld um („Reiß dich zusammen“ oder „Das kann doch nicht nur von Covid kommen“). Solche Reaktionen können sehr verletzend sein, zumal die Betroffenen sich ihre Lage selbst nicht erklären können und am liebsten jedem beweisen würden, dass sie nicht faul oder verrückt sind.
Die psychische Belastung ist enorm. Gefühle von Verzweiflung, Angst und Trauer sind an der Tagesordnung. Verzweiflung darüber, keinen Ausweg zu sehen und von der Medizin im Stich gelassen zu sein. Angst vor einer ungewissen Zukunft – werde ich jemals wieder gesund? – und vor sozialem Abstieg. Trauer um das verlorene „alte Ich“ und das Leben, das man führen wollte. Nicht wenige entwickeln eine Depression, manche haben sogar Suizidgedanken. Im August 2023 machte ein tragischer Fall Schlagzeilen: Die 56-jährige Daniela C. aus Basel, die wegen Long Covid an schwerstem ME/CFS litt, wählte den assistierten Freitod . Sie beschrieb ihr Leiden als „Krankheit der tausend Tode“ – nahezu den ganzen Tag im abgedunkelten Zimmer, unfähig zu lesen, zu sprechen oder Geräusche zu ertragen . Öffentlich hatte sie bis zuletzt für mehr Anerkennung dieser Krankheit gekämpft , doch schließlich sah sie keinen anderen Ausweg mehr und ging mit Hilfe der Sterbehilfeorganisation EXIT. Dieser extreme Fall steht für ein Tabuthema: Was, wenn die Hoffnung schwindet? Wenn ein Mensch sein Dasein als so unerträglich empfindet, dass er lieber gehen will? Long Covid kann an diesen Punkt führen. Umso wichtiger ist es, dass wir als Gesellschaft Hoffnungsschimmer aufrechterhalten und Hilfsangebote machen, bevor jemand in solche Abgründe fällt.
Aber es gibt auch Hoffnung und Zusammenhalt. Überall haben sich Patientenorganisationen und Selbsthilfegruppengebildet – in der Schweiz etwa die Organisation Long Covid Schweiz, die Betroffenen vernetzt, Informationen bereitstellt und politisch Druck macht. In diesen Communities erfahren Erkrankte: Du bist nicht allein. Der Austausch mit anderen, die das gleiche durchmachen, spendet Trost und praktische Tipps. Man motiviert sich gegenseitig an schlechten Tagen und feiert kleine Fortschritte an guten Tagen. Auch viele Angehörige suchen Rat: Wie gehe ich mit meinem chronisch erschöpften Partner um? Was sage ich meiner Freundin, die seit Monaten krank ist? Hier ist Aufklärung entscheidend, damit im Umfeld Verständnis wächst. Long Covid ist ebenso eine soziale Krankheit, die Partnerschaften, Familien und Freundeskreise auf die Probe stellt. Empathie, Geduld und Wille zur Unterstützung machen einen großen Unterschied.
Die Suche nach Lösungen treibt Betroffene indes unvermindert an. Wer gesundheitlich dazu in der Lage ist, liest Studien, probiert Therapien aus, kontaktiert Spezialisten im In- und Ausland. Dieses Engagement der Patient*innen – oft aus Verzweiflung geboren – führt manchmal zu innovativen Impulsen. So haben Patienteninitiativen viel zur Forschung beigetragen, etwa durch Crowdsourcing von Daten oder als Probanden in Studien. Einige Ärzte und Wissenschaftler, die selbst Long Covid haben, bringen sich mit besonderem Eifer ein. Und es gibt Fälle von Genesenen, die Mut machen: Menschen, die nach ein, zwei Jahren allmählich ins Leben zurückgefunden haben. Ihre Geschichten geben anderen Kraft, weiterzukämpfen.
Insgesamt entsteht ein Bild von großer Resilienz: Trotz aller Rückschläge halten viele Long-Covid-Betroffene an kleinen Hoffnungen fest – sei es eine neue Studie, die einen Therapieansatz liefert, oder einfach ein Tag, an dem man die Sonne auf der Haut spürt und merkt, dass man noch lebt. Diese Mischung aus Hoffnung und Frustration prägt den Alltag mit Long Covid.
Die Frage nach dem Wert eines Menschenlebens
Long Covid wirft letztlich eine fundamentale ethische Frage auf: Wie viel ist uns ein Menschenleben wert? Natürlich würde kaum jemand behaupten, ein Long-Covid-Patient sei „weniger wert“ als ein Gesunder. Doch in der Praxis fühlen sich viele Betroffene genau so behandelt. Wenn Krankenkassen sich weigern, eine möglicherweise hilfreiche Therapie zu bezahlen – sind ihnen dann 20’000 Franken mehr wert als das Wohlergehen eines Menschen? Wenn Forschungsvorhaben mangels Geld scheitern , wie das Zürcher Apherese-Projekt, welche Prioritäten setzen wir als Gesellschaft? Wenn junge Menschen jahrelang kein normales Leben führen können und in Armut abzurutschen drohen, weil Institutionen träge entscheiden – was sagt das über unseren gesellschaftlichen Stellenwert von Gesundheit aus?
Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass abstrakte Kosten-Nutzen-Abwägungen plötzlich sehr konkret werden, wenn tausende Individuen betroffen sind. Die Versicherer argumentieren, man könne nicht jede teure Idee finanzieren, sonst explodierten die Prämien . Das stimmt – Ressourcen sind begrenzt. Aber auf der anderen Seite stehen echte Schicksale: Menschen wie Céline, die bereit wären, alles zu geben für ein Stück Gesundheit, und deren Familie Haus und Hof riskiert für eine Chance auf Besserung . Menschen wie Daniela, die ihr Leben nicht mehr lebenswert fanden . Menschen, die uns vor der Pandemie Nachbarn, Kollegen, Freunde waren und nun um Hilfe rufen.
Ein zentrales Problem ist, dass Long Covid lange nicht ernst genommen wurde. Wer nach einer Infektion nicht genas, wurde zuweilen als psychosomatischer Fall abgestempelt – nach dem Motto: „Das ist doch Stress oder die Pandemie-Angst, nicht das Virus.“ Diese Haltung ändert sich langsam dank harter wissenschaftlicher Evidenz (wie der Gehirn-Studie oder der Autoantikörper-Forschung ). Anerkennung ist der erste Schritt: Long Covid ist real und zerstört Leben. Daraus folgt zwangsläufig, dass wir als Gesellschaft Verantwortung tragen, diesen zerstörten Leben soweit möglich wieder Sinn und Perspektive zu geben.
Der Wert eines Menschenlebens bemisst sich nicht in Franken und nicht in Produktivität. Er bemisst sich in der Würde, die wir jedem Einzelnen zugestehen – gerade wenn er schwach ist. Long-Covid-Patienten spüren derzeit oft das Gegenteil: Sie müssen kämpfen, um gehört und versorgt zu werden. Doch es regt sich auch Solidarität. Das Bundesgerichtsurteil kann man als Signal lesen, dass im Zweifel für das Leben entschieden wird, nicht für die Bilanz . Auch Spendenaktionen, politische Vorstöße und mediale Berichterstattung tragen dazu bei, den Wert dieser Menschenleben sichtbar zu machen: Denn jeder dieser Patienten hatte Träume, Angehörige, einen Platz in der Gesellschaft – und könnte ihn mit der richtigen Unterstützung vielleicht wieder einnehmen.
Am Ende steht die Erkenntnis: Long Covid ist nicht nur eine medizinische Herausforderung, sondern ein gesellschaftlicher Spiegel. Er zeigt, wie wir mit chronisch Kranken umgehen, wie viel Empathie wir aufbringen und wie flexibel unsere Institutionen in einer Krise reagieren. In der Schweiz, einem der reichsten Länder der Welt, sollte niemand das Gefühl haben müssen, sein Leben sei „zu teuer“ oder „nicht wichtig genug“. Jede*r Betroffene ist eine Mahnung, den Menschen hinter den Kosten zu sehen.
Die Frage nach dem Wert eines Menschenlebens lässt sich nicht in Zahlen beantworten. Aber wir beantworten sie tagtäglich durch unser Handeln: indem wir Long-Covid-Betroffene nicht vergessen, ihre Geschichten erzählen, Forschung fördern, Versorgung verbessern und füreinander einstehen. Long Covid mag noch Jahre viele vor Rätsel stellen – doch im Kern geht es darum, die Würde und Lebensqualität der Betroffenen in den Mittelpunkt zu stellen. Darin zeigt sich, was uns ein Menschenleben wirklich wert ist.
Und was heisst das alles nun für Betroffene?
Fazit: Long Covid in der Schweiz erfordert ein Umdenken auf vielen Ebenen. Die Wissenschaft arbeitet mit Hochdruck daran, das Puzzle dieser Krankheit zu lösen – von Immunreaktionen bis Mikrogerinnseln. Im Gesundheitswesen und in der Versicherungslandschaft müssen flexible Lösungen gefunden werden, um den neuartigen Herausforderungen gerecht zu werden. Vor allem aber braucht es Mitgefühl, Solidarität und einen langen Atem. Denn Long Covid ist ein Marathon, kein Sprint: für die Medizin, die Behörden und vor allem für die Betroffenen selbst. Gemeinsam müssen wir dafür sorgen, dass aus Verzweiflung wieder Hoffnung wächst – und dass die Lehren aus Long Covid künftigen Generationen zugutekommen, sollte uns jemals wieder eine ähnliche Krise treffen.